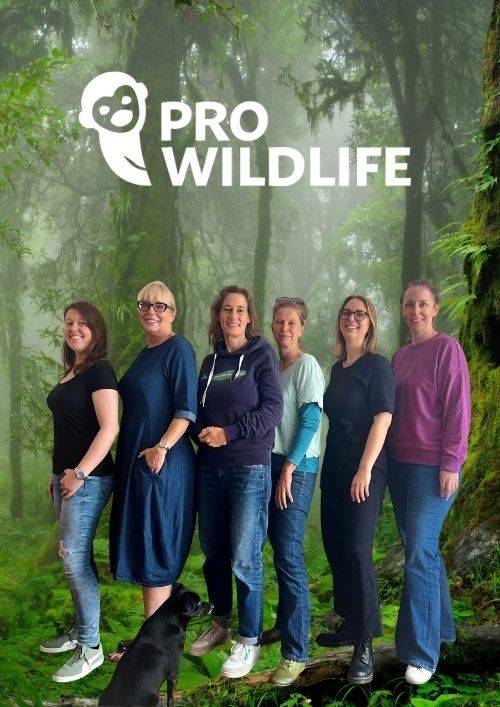Pro Wildlife
rettet Wildtiere in Not, schützt die Artenvielfalt und begeistert Menschen für den Tierschutz – vor Ort und am Verhandlungstisch.
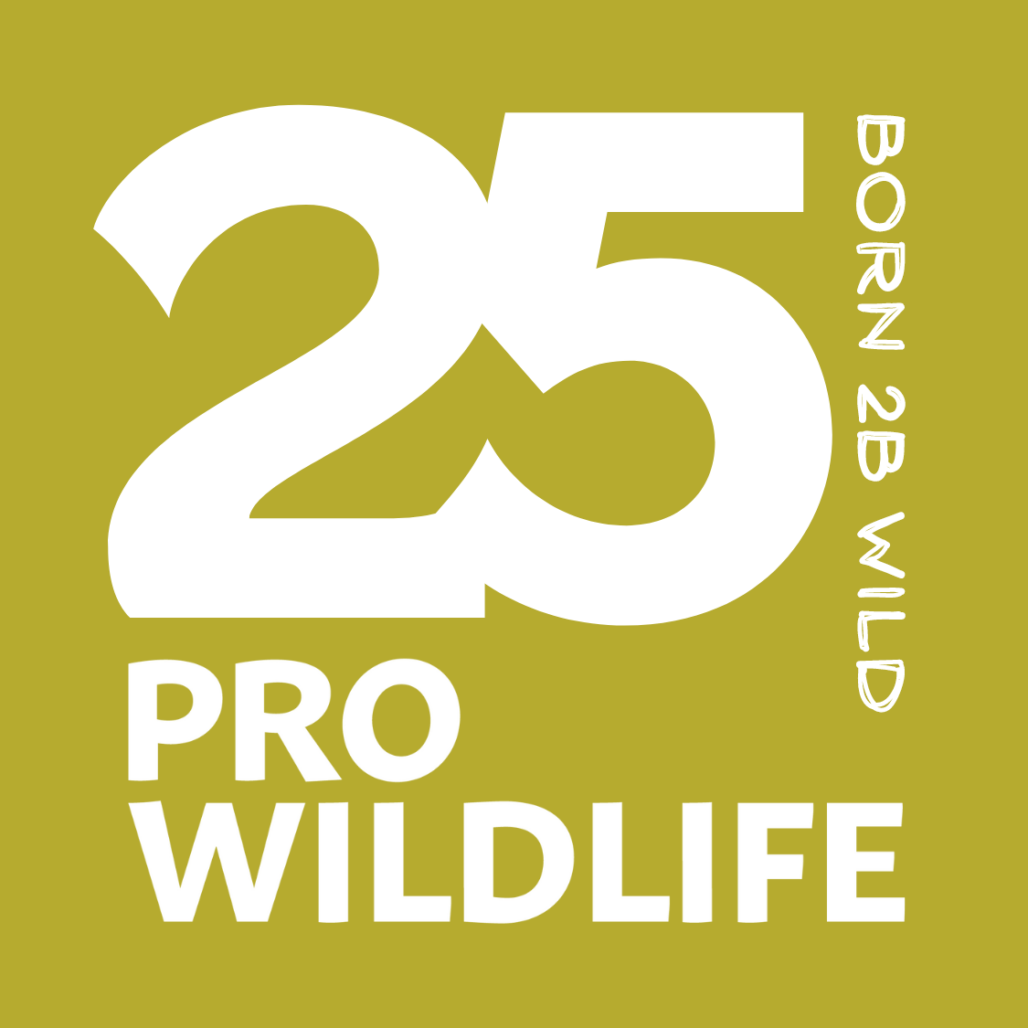
2024 feiern wir 25 Jahre Pro Wildlife! Grußbotschaften zum Jubiläum aus aller Welt, eine kleine Zeitreise und wofür wir uns auch in Zukunft einsetzen werden, sehen Sie hier >>
Wir freuen uns über jeden Erfolg auf politischer Ebene, jeden verhinderten Tierschmuggel und jedes gerettete Tier.
Hier 25 der größten Erfolge von Pro Wildlife >>
Ob Tierrettung oder Schutz von Lebensraum: Damit wir mit unserem Einsatz auch künftig Fortschritte machen, brauchen wir Ihre Hilfe. Denn gemeinsam erreichen wir noch mehr! Meine Spende für Wildtiere >>
Der Handel mit über 480 bedrohten Tierarten wurde weltweit mit Pro Wildlifes Hilfe verboten oder eingeschränkt
Mithilfe der Spenden aus dem 24-Gute-Taten-Kalenderverkauf wird 2026 unser Einsatz gegen Wildtierkriminalität in Westafrika finanziert.
Pro Wildlifes Kampagne gegen den Einsatz von Elefanten als Reiseattraktion bewegt die Tourismus-Branche zum Wandel
Woran Pro Wildlife arbeitet
Wer wir sind
Das Team von Pro Wildlife setzt sich tagtäglich für den Tier- und Artenschutz ein.
Um den Schutz für Wildtiere langfristig zu verbessern, klären wir die Öffentlichkeit über Missstände auf und sitzen mit Entscheidungsträger*innen am Verhandlungstisch. Ergänzend zu der politischen Arbeit unterstützen wir Schutzprojekte vor Ort, wo wir Wildtiere in Not retten und das friedliche Zusammenleben von Mensch und Tier fördern.
Seit 1999 sind wir mit Herzblut und Expertise bei der Sache: Wir geben den Wildtieren eine Stimme!